-
:: Verstreute
::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::: Werke :: Reinhard Kaisers
:::::::::::::::::::::: Elektroarchiv :::::
Zurück zu Verstreute Werke
Der Wächter des Generals
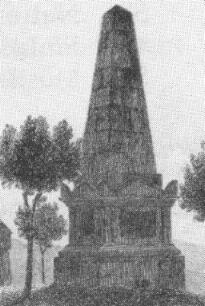 Auf
einer Anhöhe oberhalb von Weißenthurm, zwischen Koblenz und
Andernach, steht ein Obelisk — so breit wie die ägyptischen,
aber
nur halb so hoch. Die Soldaten der französischen Sambre- und
Maas-Armee
haben ihn zum Andenken an ihren général en chef,
Lazare
Hoche, auf eben jenem Hügel errichten lassen, von dem der General
im April 1797, ein paar Monate vor seinem Tod, den Rheinübergang
seiner
Truppen nach Neuwied leitete. Den Fluß sieht man noch heute von
dort
oben, auch das andere Ufer mit seinen dicht bewaldeten Bergen, und im
Süden,
aus dem flachen Becken aufragend, das sich bis Koblenz dehnt, den stark
taillierten und dennoch unförmigen Kühlturm eines
stilliegenden
Atomkraftwerks.
Auf
einer Anhöhe oberhalb von Weißenthurm, zwischen Koblenz und
Andernach, steht ein Obelisk — so breit wie die ägyptischen,
aber
nur halb so hoch. Die Soldaten der französischen Sambre- und
Maas-Armee
haben ihn zum Andenken an ihren général en chef,
Lazare
Hoche, auf eben jenem Hügel errichten lassen, von dem der General
im April 1797, ein paar Monate vor seinem Tod, den Rheinübergang
seiner
Truppen nach Neuwied leitete. Den Fluß sieht man noch heute von
dort
oben, auch das andere Ufer mit seinen dicht bewaldeten Bergen, und im
Süden,
aus dem flachen Becken aufragend, das sich bis Koblenz dehnt, den stark
taillierten und dennoch unförmigen Kühlturm eines
stilliegenden
Atomkraftwerks.
Das Grabmal des Generals Hoche ist kein besonders wichtiger Schauplatz in meinem Buch (1), aber der einzige, der sich von Mainz bequem an einem Nachmittag erreichen läßt. Deshalb habe ich den Fernsehleuten, die einen kurzen Film über das Buch drehen wollen, vorgeschlagen, nach Weißenthurm zu fahren. Das Monument und der Fluß würden eine interessantere Kulisse für das geplante Interview abgeben als mein Arbeitszimmer, habe ich der Redakteurin versichert. Und nun spielt sogar das Wetter mit. Es ist kalt und nieselt immerzu — genau wie in meinem Buch.
Der Obelisk steht, wie es scheint, auf französischem Territorium. An dem Tor aus schwarzen Eisenstäben, durch das wir den kleinen Park um das Denkmal betreten, prangen die vergoldeten Buchstaben »RF« — République Française. Bei meinem ersten Besuch, in der Zeit, als ich noch an dem Buch arbeitete, war mir das Monogramm nicht aufgefallen. Jetzt fragt mich der Kameramann, ob wir am Ende gar irgendwo eine Dreherlaubnis einholen müßten.
Doch aufhalten lassen wir uns durch solche Erwägungen nun nicht mehr. Zögernd, weil wahrscheinlich unbefugt, betreten wir das ungewisse Terrain — der Kameramann mit geschultertem Gerät, seine Assistentin hinter ihm, das Stativ schleppend, die Redakteurin mit einer geräumigen Tasche über der Schulter und einem Aluminiumkoffer in der Hand. Nur ich bin nicht schon auf den ersten Blick verdächtig. Von mir stammt ja bloß die Idee, hierher zu fahren. Und diese Idee sieht man nicht.
Plötzlich hören wir hinter uns Schritt. Ein schmaler Mann mit wachsbleichem Gesicht ist uns gefolgt. Unter einem ausgespannten Schirm steht er im Nieselregen. Mitte fünfzig, vielleicht älter. Er trägt einen einfachen Mantel und spricht. Nicht zu uns, sondern vor sich hin. In unsere Richtung.
Ich verstehe nicht gleich, in welcher Sprache, und noch länger dauert es, bis ich anfange zu begreifen, was er uns sagen will. Aber ich ahne schon, daß er der Bewacher dieses Denkmals ist.
Er fragt, ob wir hier Aufnahmen machen wollen, und als ich mit zaghaftem Nicken und »Oui, monsieur« zugebe, was sich ohnehin nicht verheimlichen läßt, da verkündet er, daß es nicht möglich sei, das Monument zu photographieren.
Der Kameramann, seine Assistentin und die Redakteurin verstehen anscheinend kein Französisch. Aber sie wittern Komplikationen. Ich wittere sie ebenfalls.
Der bleiche Franzose hat vier Postkarten bei sich, auf denen der Obelisk des Generals Hoche zu sehen ist. Die bietet er uns an. Sie sind in grünlichem Schwarz auf dünnem, grauem Karton gedruckt — matte, unansehnliche Bilder. Heute sei es nicht mehr möglich, das Monument in dieser Vollständigkeit zu photographieren, den kompletten Obelisken mit dem Eingang zur Gruft. Bäume seien gewachsen. Gebüsch verstelle den Blick. Mir wird klar, daß dieser Mann uns nichts verbieten will. Er beschreibt nur die Vorzüge seiner Postkarten. Er hält sie dicht vor mich. Er will, daß ich zugreife, und als ich zögere, beteuert er: »Mais, c´est gratuit!« und drückt mir zwei seiner kostenlosen Karten in die Hand. Ich bedanke mich in seiner Sprache, so freundlich ich kann, und schon erbietet er sich, mich in die Gruft selbst unter dem Obelisken zu führen.
So viel Entgegenkommen kann ich unmöglich ausschlagen, auch wenn der Kameramann meint, der Regen werde jeden Moment aufhören, und dann sollten wir doch bitte die Gelegenheit nutzen und das Interview drehen. Ich folge dem Franzosen zu einer Gittertür im hohen Sockel des Denkmals. Umständlich klappt er seinen Regenschirm zusammen, klemmt ihn unter den Arm und sucht aufgeregt, mit beiden Händen zugleich, in den Taschen seines Mantels nach dem Schlüsselbund.
Durch einen dunklen Gang führt er mich in den Raum unter dem Obelisken. Die Wände ringsum sind mit verstrohten Blumenkränzen und blaß gewordenen Trikoloren geschmückt. Hier unten, meint er, sollten wir filmen. Er werde die Blenden von den Lichtschächten nehmen. Heute sei es leider besonders trüb, aber manchmal — hier verklärt sich etwas in seiner Stimme —, manchmal falle ein Licht in die Gruft, daß der Marmor ganz weiß zu schimmern beginne, wie ein Schneefeld. Der General befinde sich übrigens nicht im Sarkophag. Der General befinde sich in der Urne, die auf dem Sarkophag steht. Der General ist spürbar anwesend. Nicht seine sterblichen Überreste ruhen in der Urne. Er selbst hält sich darin auf.
»Hier sollten Sie drehen«, wiederholt der Wächter. »Ça intéresse les allemands!«
Während wir zu den anderen zurückkehren, erkläre ich ihm, was wir vorhaben: daß wir für das Fernsehen einen kleinen Film über ein Buch von mir drehen wollen und daß in diesem Buch der Obelisk des Generals Hoche vorkommt. Ich kann erkennen, wie dieser Gedanke Besitz von ihm ergreift und wie sehr er ihn entzückt. Wovon das Buch handle, fragt er mich, während er die Gittertür hinter uns verschließt. »Vom Regen«, antworte ich, »von dem berühmten Lord Byron und seinem médecin inconnu.« Auf ihrer Reise an den Genfer See seien die beiden hier vorbeigekommen und hätten das Denkmal besucht, im kalten Sommer des Jahres 1816, ein Jahr nach Waterloo. Täusche ich mich, oder versteht er den Namen Waterloo wirklich nicht? Will er ihn nicht verstehen? Es könnte hier draußen etwas ordentlicher aussehen, meint er. Gestern habe er Laub fegen wollen, und vorgestern auch, aber das Wetter sei ihm dazwischengekommen. »Et que voulez-vous? C´est vieux d´ailleurs!« Wenn ein Denkmal erst einmal so alt geworden sei, verliere die Beseitigung von welken Blättern ihre Dringlichkeit. Er will mich nicht fortlassen. »Kommen Sie«, sagt er, »es dauert nur einen Augenblick! Ich möchte Ihnen etwas zeigen, das sehen die Leute nie!«
Auch ich habe bei meinem ersten Besuch die mit kniehohen schwarzen Gittern eingefaßte Stelle hinter ein paar Sträuchern nicht bemerkt. »Das ist die Platte des ersten Grabes aus der Zeit, bevor das Monument errichtet wurde. Da lag der General« — der Wächter stockt, setzt von neuem an, stockt wieder — »da lag er in Koblenz, neben Marceau, der fiel, bei Altenkirchen, der General fiel nicht, der General starb, in Wetzlar, an einer Krankheit, ein Jahr nach Marceau, im September 1797. Im Frühjahr hatte er noch den Feldzug eröffnet, hier... an dieser Stelle... über den Rhein... ein kühner Mann... acht Fahnen nahm er den Österreichern bei Neuwied ab... acht Fahnen, fünftausend Männer, sechzig Munitionswagen, siebenundfünfzig Kanonen...« Die Erklärungen werden immer aufgeregter, geraten ins Straucheln, überstürzen sich, und eine Zeitlang tue ich nur noch so, als könnte ich folgen — bis mir plötzlich klar wird, daß der Wächter nicht mehr über das Denkmal und die beiden Generäle und ihre Heldentaten spricht, sondern mir zu erklären versucht, warum er so sehr ins Stottern geraten ist. Seit sechs Jahren sei er hier. Spreche kein Deutsch. Habe keinen Umgang mit den Einwohnern des Ortes. »Pour moi, ce n´est pas une ville.« Franzosen kämen so selten hierher, daß er jedesmal ins Stammeln gerate, wenn er längere Zeit spreche. Nach und nach legt sich die Verstörung in seiner Stimme. Doch ganz verschwindet sie an diesem Nachmittag nicht mehr.
Während ich auf dem Sockel des Obelisken das Interview
absolviere,
verbirgt sich der Wächter in den Grünanlagen. »Je ne
vous gêne pas«, sagt er, ehe er sich zurückzieht,
und wedelt dabei beschwichtigend mit den Händen.
Zuletzt soll auch das Buch selbst noch ins Bild gesetzt
werden. Aber nirgendwo findet sich ein trockener Platz. »Das ist
mein Exemplar!« ruft die Redakteurin. Trotzdem
muß der
Kameramann es ins Nasse stellen, auf eine feuchte Mauer.
Ich werde nicht mehr gebraucht und mache mich auf die
Suche nach dem Wächter des Generals. Hinter einem Gebüsch
finde
ich ihn. Er hat auf mich gewartet und lächelt verlegen. Ob er mit
seiner Familie hier lebe, frage ich ihn. Nein, antwortet er, ganz
allein.
Seit sechs Jahren. »Ich wollte hier so viel machen. Bäume
pflanzen.
Beete anlegen. Aber nie ist Geld da. Nur für das
Allernötigste.«
Vor ein paar Jahren drohte der Obelisk in Stücke zu fallen, da
habe
man ihn notdürftig restauriert, jedoch längst nicht so, wie
es
richtig und angemessen gewesen wäre. In der Hitlerzeit hätten
deutsche Polizisten das Monument vor Übergriffen geschützt.
Ein
anderes französisches Denkmal in der Gegend sei damals
zerstört
worden.
Was er getan habe, bevor er das Denkmal zu hüten
begann, frage ich. »Oh«, sagt er, »ich bin gereist
—
vierunddreißig Jahre lang bin ich gereist.« —
»Tatsächlich?
Vierunddreißig Jahre unterwegs und dann plötzlich sechs
Jahre
an einem Fleck?« Er nickt. »J´ai fait ce
qu´on
appelle en français la >Coloniale<.« Er war
Soldat
— nach dem Krieg zuerst in Deutschland, dann in Übersee,
Marokko,
Tunesien, Vietnam, Djibouti, Madagaskar, Algerien, und nun sei er hier,
angestellt und bezahlt von einer Abteilung des Außenministeriums
in Paris.
»Haben Sie noch eine Minute?« fragt er.
»Nur
eine Minute! Kommen Sie, da gibt es noch etwas!«
Er führt mich durch das Gittertor mit den vergoldeten
Initialen hinaus und über die Straße zu seinem Haus. Neben
der
Tür hängt ein verwittertes blaues Holzschild mit der
weißen
Aufschrift »Surveillant«.
»Ich kann Sie nicht in meine Wohnung
einladen«,
entschuldigt er sich. »Als ich diese Wohnung vor sechs Jahren
übernahm,
war sie grauenhaft, und ich habe mich so geärgert, daß ich
nichts
verändert habe. Ich habe alles so gelassen, wie es war — pas
bon.«
Also bleiben wir im Hausflur stehen. Hier hängen die beiden
Bilder,
die er mir zeigen will: Schüler aus Andernach, die vor ein paar
Jahren
eine Zeitung über das Denkmal hergestellt haben, umringen ihren
Lehrer.
In einem zweiten Rahmen die gleiche Gruppe, aus einem anderen
Blickwinkel,
in größerem Format. Der Surveillant drückt mir ein
Papier
in die Hand, das er aus einem Schrank genommen hat, ein Exemplar jener
Andernacher Schülerzeitung. »Wie gut, daß ich noch
rechtzeitig
nach Hause gekommen bin«, sagt er. Er habe schließlich
nichts
dagegen, daß bei ihm gefilmt werde. Im Gegenteil. Aber es
würde
ihn gewurmt haben, wenn er nichts davon mitbekommen hätte. Ich
versuche
mich zu verabschieden, doch er will mich noch immer nicht gehen lassen.
»Was war das für ein Buch, von dem Sie da vorhin
sprachen?«
fragt er. »Ich möchte es kaufen. Wovon, sagten Sie, handelt
es? Vom Regen?« — »Ja, vom Regen.« Ich
verabschiede mich
noch einmal. Aber diese Zeitung, sage ich zuletzt, die koste doch
etwas,
und das wolle ich auch bezahlen. »Mais non«, er hebt
abwehrend eine Hand und winkt, »c´est gratuit ... tout
est
gratuit.«
(1) Der kalte Sommer des Doktor Polidori (in dem Kapitel "Rheinaufwärts"). Zum Anfang dieses Romans gelangt man hier.
Zurück zu Verstreute Werke
Erstdruck in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, 31. August 1997. (c) Reinhard Kaiser.