-
Verstreute Werke
:::::::::::::::::::::
Reinhard Kaisers Elektroarchiv
Zurück zu Verstreute
Werke
Witze und Wunden
Über Nancy Mitford und ihre Romane
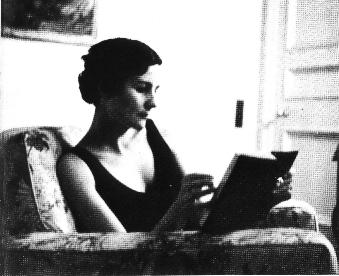 Auf
der Höhe ihres schriftstellerischen Ruhms, im Jahre 1953 oder
1954,
erhielt Nancy Mitford einen Brief aus New York, in dem sie gebeten
wurde,
für den ersten Ergänzungsband eines amerikanischen Lexikons
über
die Literatur des 20. Jahrhunderts eine autobiographische Skizze
beizusteuern.
Aber Nancy Mitford mochte die Amerikaner, um es vorsichtig
auszudrücken,
nicht besonders - noch weniger als die Deutschen. Als Käufer ihrer
Romane waren sie ihr natürlich willkommen. Aber die amerikanische
Literaturkritik hatte sich daran gemacht, in ihren Romanen nach
tieferem
Sinn zu suchen, und war nicht recht fündig geworden. Die
Rezensenten
vermißten eine moralische Botschaft, mißbilligten den
Leichtsinn
dieser Bücher, tadelten ihre Frivolität, kurzum, sie legten
jene
gouvernantenhafte Haltung an den Tag, die Nancy Mitford dazu brachte,
die
Amerikaner allesamt als "Govs" zu bezeichnen. Und denen mochte sie
über
sich selbst nichts preisgeben, ohne sie auf den Arm zu nehmen. Ob die
Lexikon-Redaktion
in New York es bemerkt hat? Sie ließ jedenfalls den Text, den
Nancy
Mitford ihr schließlich übermittelte, anstandslos drucken.
Auf
der Höhe ihres schriftstellerischen Ruhms, im Jahre 1953 oder
1954,
erhielt Nancy Mitford einen Brief aus New York, in dem sie gebeten
wurde,
für den ersten Ergänzungsband eines amerikanischen Lexikons
über
die Literatur des 20. Jahrhunderts eine autobiographische Skizze
beizusteuern.
Aber Nancy Mitford mochte die Amerikaner, um es vorsichtig
auszudrücken,
nicht besonders - noch weniger als die Deutschen. Als Käufer ihrer
Romane waren sie ihr natürlich willkommen. Aber die amerikanische
Literaturkritik hatte sich daran gemacht, in ihren Romanen nach
tieferem
Sinn zu suchen, und war nicht recht fündig geworden. Die
Rezensenten
vermißten eine moralische Botschaft, mißbilligten den
Leichtsinn
dieser Bücher, tadelten ihre Frivolität, kurzum, sie legten
jene
gouvernantenhafte Haltung an den Tag, die Nancy Mitford dazu brachte,
die
Amerikaner allesamt als "Govs" zu bezeichnen. Und denen mochte sie
über
sich selbst nichts preisgeben, ohne sie auf den Arm zu nehmen. Ob die
Lexikon-Redaktion
in New York es bemerkt hat? Sie ließ jedenfalls den Text, den
Nancy
Mitford ihr schließlich übermittelte, anstandslos drucken.
"Mein Vater war der zweite Sohn eines englischen Peers;
meine Mutter
war eine Schönheit. In England bekommen nachgeborene Söhne
kein
Geld, und so wurde ich in einem armen Londoner Slum geboren. Da mein
Vater
unbedingt sieben Bluthunde und ein Pony zum Reiten für mich halten
wollte, herrschte ein ziemliches Gedränge. Doch während des
ersten
Krieges gegen die Deutschen fiel der älteste Bruder meines Vaters,
und mein Vater wurde Lord Redesdale. Danach lebten wir in einem
geräumigen
Haus in den Cotswold-Bergen. Ich hatte fünf Schwestern und einen
Bruder.
Mein Vater und meine Mutter, beide selbst ungebildet, waren gegen
Bildung,
und uns Mädchen wurde auch keine zuteil, wenngleich man uns Reiten
und Französischsprechen beibrachte. Mein Bruder ging nach Eton.
Ahnungslos wie eine Eule wuchs ich auf, wurde
in London
in die Gesellschaft eingeführt und besuchte zahllose Bälle.
Hier
lernte ich Menschen kennen, die ganz und gar nicht ahnungslos waren -
ich
freundete mich mit einem Kreis von Leuten an, zu dem die Herren Henry
Green,
Evelyn Waugh, John Betjeman, Sir Maurice Bowra und der brillante Lord
Berners
gehörten (der auf eigenen Wunsch als Lord Merlin in meinem Roman Englische
Liebschaften auftritt). Sehr bald wurde ich ein intellektueller
Snob.
Ich versuchte mich selbst zu bilden, las sehr viel und schrieb einige
mittelmäßige
Romane. Ich heiratete einen Mann, dessen Lieblingslektüre die
griechischen
und römischen Klassiker sind.
Als der Krieg ausbrach, wurde ich Leiterin der
Buchhandlung
Heywood Hill, da Mr. Hill selbst zum Militär einberufen worden
war.
Zum erstenmal in meinem Leben arbeitete ich hart und zu
regelmäßigen
Zeiten; ich kann nicht sagen, daß es mir gefiel, aber die
Disziplin,
der ich mich unterwerfen mußte, machte es mir möglich, viel
bessere Bücher zu schreiben. Der Roman Englische Liebschaften,
den ich 1945 schrieb, wurde sofort ein Bestseller. Ich verließ
die
Buchhandlung und ging nach Paris, wo ich mich auf Dauer angesiedelt
habe
und weiter an meiner Bildung arbeite." (1)
In seinen Hauptzügen und den Eckdaten vermittelt dieses
Selbstporträt
durchaus einen Eindruck vom Lebensweg und Bildungsgang einer Autorin,
deren
Bücher damals in aller Munde waren. Aber nicht alle Angaben halten
einer näheren Prüfung stand, und viele Akzente sind ein wenig
sonderbar gesetzt - sonderbar bis zur Irreführung! Etwa der
Hinweis
auf den klassikerliebenden Ehemann. Mag sein, daß Peter Rodd, mit
dem Nancy Mitford seit 1933 verheiratet war, die antike Literatur
liebte
- vor allem aber liebte er andere Frauen, so sehr, daß Nancy bald
gar nicht mehr verstand, warum er sie und sie ihn überhaupt
geheiratet
hatte. Jedenfalls lebten die beiden schon in der Zeit vor dem Zweiten
Weltkrieg
getrennt, und als Nancy ihre Notiz für das amerikanische Lexikon
schrieb,
wollte sie von ihrem Ehemann nur noch eines: die Scheidung, die 1957
schließlich
auch zustande kam.
Doch wie immer es um den Wahrheits- oder Halbwahrheitsgehalt einzelner
Sachaussagen bestellt sein mag - diese autobiographische Notiz zeugt
von
einem Charakterzug Nancy Mitfords, der für ihren Umgang mit
Menschen
und für ihr Schreiben gleichermaßen prägend war, von
dem
Vergnügen, mit dem sie immer wieder daran ging, andere Leute,
Freunde,
Bekannte, Angehörige, die Empfänger ihrer Briefe, die Leser
ihrer
Romane oder, wie in diesem Fall, die amerikanischen Lexikographen und
deren
Leser in ihren Witz zu verwickeln. Sie zeugt von ihrer Lust an dem, was
die Engländer teasing nennen - das bedeutet: Hänseln,
Aufziehen, Necken, Frotzeln, auf den Arm nehmen, stichelnder Witz,
gewitztes
Sticheln.
In London kam Nancy Mitford tatsächlich zur Welt - am
28. November
1904. Insoweit treffen ihre Angaben zu. Aber das Haus, in dem sie
aufwuchs,
lag keineswegs in einem Slum, sondern in einer zwar nicht besonders
vornehmen,
aber auch nicht besonders verkommenen Wohngegend, und zum Haushalt
gehörten
schon damals, als ihr Vater noch nicht Lord Redesdale, sondern David
Mitford
hieß, immerhin fünf Dienstboten. Über die Geburt von
Nancy,
hat sich dieser Vater sehr gefreut, obwohl er sich schon bei diesem
ersten
Mal, wie später jedesmal, wenn seine Frau schwanger wurde, einen
Sohn
erhoffte. In diesem Punkt sollte er im Laufe der Jahre noch
fünfmal
enttäuscht werden. Einmal allerdings erfüllte sich seine
Hoffnung.
Tom nahm in der Reihe der Kinder den dritten Platz ein. Vor ihm kam die
zweite Tochter zur Welt, für Nancys Entwicklung, wie es scheint,
ein
besonders schwerer Schlag.
Wenige Tage vor ihrem dritten Geburtstag, verlor
sie von heute auf morgen innerhalb der Familie die bevorzugte Stellung
des allseits angebeteten Einzelkindes. Pamela, die erste Schwester, war
da, und das Kindermädchen der Mitfords übertrug seine ganze
Liebe
sogleich auf das Neugeborene. Nancy erhob ein so anhaltendes Geschrei,
daß sich die Mutter bald genötigt sah, eine neue "Nanny"
einzustellen,
die eher imstande war, ihre Zuneigung gleichmäßig auf die
Kinder
in ihrer Obhut zu verteilen. Doch zu spät. Die kleine Nancy hatte
schon begonnen, an der noch kleineren Pamela grausame Rache zu nehmen,
und hörte so bald nicht mehr auf damit. Wo sich eine Chance bot,
der
Jüngeren einen Spaß zu verderben, wurde dieser Spaß
verdorben,
mit einem Einfallsreichtum, dem die arme Pam nicht gewachsen war und
von
dessen einschüchternder Wirkung sie sich auch später nie ganz
erholt hat. Die Sache wurde nicht besser, als weitere Geschwister in
Erscheinung
traten, der Bruder Tom und die Schwestern Diana, Unity, Jessica und
Deborah.
In der Abgeschiedenheit des Landsitzes, den die Familie bewohnte,
nachdem
der Vater geerbt hatte, waren die Jüngeren in wechselnden
Verbindungen
füreinander Spielkameraden. Nancy indessen blieb ziemlich
isoliert,
weil sie es nicht lassen konnte, immer wieder ihre schärfste Waffe
blitzen zu lassen, das spöttische Gestichel, das Frotzeln und
"Lästern"
- eben das teasing. Eine der Leidtragenden, Nancys
zweitjüngste
Schwester Jessica, berichtet darüber in ihren Erinnerungen:
Nancy war zu scharfzüngig und sarkastisch, als daß sie über längere Zeit die Lieblingsschwester von einem von uns hätte sein können. Ganz plötzlich konnte sie einen aus ihren durchdringenden smaragdgrünen Augen ansehen und sagen: "Ab mit dir ins Schulzimmer; wir alle haben jetzt wirklich genug von dir." Und wenn man sich besonders viel Mühe mit den Ringellöckchen gegeben hatte, brachte sie es fertig zu sagen: "Du siehst heute aus wie die älteste und häßlichste der Brontë-Schwestern." (2)
Ihre drei jüngsten Schwestern traktierte sie einmal mit
der Bemerkung:
"Ist euch eigentlich schon aufgefallen, wie scheußlich die
mittleren
Silben eurer Vornamen klingen - Nit, Sic und Bor?" (3) Und schon
heulten sie los - Unity, Jessica und Deborah. Denn nit bedeutet
im Englischen Schwachkopf, sick soviel wie Kotze, und ein bore
ist ein Langweiler.
Grausame Scherze, herzlose Reden, gewiß - doch
zeugen
sie von einem nicht unbeträchtlichen Witz, und es scheint so, als
wäre aus dem, was für das friedliche, tränenfreie
Zusammenleben
im Hause Mitford nicht förderlich gewesen sein kann, der Literatur
zuletzt ein großer Gewinn erwachsen. Der Blick für die
Stelle,
an der der andere durch ein Wort oder eine knappe Bemerkung zu treffen
ist, der Sinn für den richtigen Zeitpunkt, an dem eine solche
Pointe
lanciert werden muß, damit sie ihre größtmögliche
Wirkung entfaltet, das Geschick, die rhetorischen Stichelwaffen immer
wieder
neu anzuspitzen - das alles sind Fertigkeiten, die Nancy Mitford im
Kinderzimmer
entwickelt hat und die ihren Romanen sehr zugute gekommen sind. Und
fast
scheint es, als sei die Lust am Frotzeln für Nancy Mitford der
eigentliche
oder jedenfalls ein wichtiger Ansporn zum Schreiben gewesen.
Aus der Zeit, in der sie an ihrem ersten Buch arbeitete,
das dann, übrigens ohne viel Aufsehen zu erregen, 1931 erschien,
berichtet
ihre Schwester Jessica:
Monatelang saß Nancy am Kamin im Salon und wußte sich vor Kichern kaum zu lassen, während ihre seltsam dreieckigen, grünen Augen vor Vergnügen blitzten und ihr dünner Stift die Linien eines Schulheftes entlangflog. Manchmal las sie uns ein Stück daraus vor. "Das kannst du nicht unter deinem Namen veröffentlichen", erklärte meine Mutter entrüstet, denn nicht nur notdürftig verkleidete Tanten, Onkel und Freunde der Familie bevölkerten die Seiten von Highland Fling, überlebensgroß trat darin auch unter dem treffenden Namen "General Murgatroyd" unser Vater, genannt Farve, auf. ... Der General war als ein begeisterter Veranstalter von Jagdgesellschaften porträtiert - ein Mann von ungestümem Temperament, der Schrecken aller Hausmädchen und Wildhüter, der die meiste Zeit damit verbrachte, auf die Hunnen [also die Deutschen] zu schimpfen und über verschiedene blasierte, junge Ästheten in pastellfarbenen Seidenhemden herzuziehen... Das seltsame Kauderwelsch meines Vaters - "Verdammter Gulli!" - "Das stinkt zur lieben Hölle!" - und sein Abscheu gegen alles, was nach Literatur und Kunst schmeckte, waren sehr gut getroffen. (4)
In der Zeit zwischen den Weltkriegen, vor allem gegen Ende
der zwanziger
und zu Beginn der dreißiger Jahre, erlebte der Witz in Englands
Oberklasse
und zumal in deren jugendlicher Fraktion eine Hochkonjunktur. Unter
kreischendem
Gelächter, klatschsüchtig, modebewußt und affektiert,
setzte
sich da eine jeunesse dorée von der Generation der
Eltern,
vom Biedersinn und von der Prüderie der viktorianischen und
edwardianischen
Ära ab. Bright Young Things nannten sich die
extravaganten
jungen Leute. Und Lord Redesdale konnte schon die gemäßigten
Exemplare dieser Spezies, die Nancy bisweilen nach Swinbrook einlud,
nicht
ausstehen. Vom Krieg, vom Jagen und anderen outdoor-Vergnügungen
wollten diese Schnösel und diese jungen Dinger nichts wissen.
Statt
dessen amüsierten sie sich im Salon mit Geplauder über Leute
und Literatur und heckten ihren nächsten Streich aus. "Wir hatten
ein absolut wildes Wochenende", schrieb Nancy über eine dieser
Partys
an ihren Bruder Tom. "Ehrlich, soviel habe ich noch nie gelacht. Wir
entwickelten
einen fürchterlichen Haß auf Prinzessin Elizabeth ... Wir
streuen
jetzt überall das Gerücht aus, sie habe Schwimmhäute
zwischen
den Zehen."
Der Witz war für Nancy Mitford aber nicht nur
Instrument
der Selbstbehauptung gegenüber den Geschwistern und nicht allein
ihr
wirksamstes Mittel in der Auseinandersetzung mit dem
herrschsüchtigen,
zu unberechenbaren Wutanfällen neigenden Vater. Nicht nur andere
Personen
in ihrer Umgebung versuchte sie, mit seiner Hilfe zu bändigen oder
in Schach zu halten. Auch den eigenen Schmerz, die Kränkungen, die
ihr widerfuhren, hat sie durch Witz niederzuzwingen versucht. Nicht die
Ohren oder, wie die Engländer sagen, die Oberlippe steif halten,
sondern
einen Witz machen - darin vor allem sah Nancy Mitford ein Mittel,
Unglück
und Kummer zu bewältigen.
Etwa jene Verwundungen, die sie in ihrer ersten Liebe
zu einem jungen Mann erlitt. Hamish St. Erskine war selbst ein witziger
Kopf, ein unterhaltsamer, von Einfällen und blitzenden
Formulierungen
sprühender Gesprächspartner. Aber er hatte nicht die Absicht,
sich im Ernst auf Nancy einzulassen. Über fünf Jahre hin zog
sich die Kette der Verlobungen, der Zerwürfnisse und dramatischen
Trennungen, bis Nancy schließlich erkannte, daß Hamishs
homosexuelle
Tendenzen keine vorübergehende "Phase" bildeten, sondern einer
dauerhaften
Orientierung entsprachen. An einem der vielen Tiefpunkte dieser
quälenden
Beziehung wollte sich Nancy, die damals im Haus einer Freundin in
London
wohnte, das Leben nehmen. In einem Brief an einen Freund schreibt sie
darüber:
Ich habe versucht, Selbstmord zu begehen, mit Gas, es ist ein angenehmes Gefühl, wie wenn man Betäubungsmittel bekommt, also werden mir von nun an die Lehrerinnen nicht mehr leid tun, die sich auf diese Weise umbringen, aber mittendrin fiel mir ein, daß Romie, bei der ich wohne, vielleicht eine Fehlgeburt haben würde, was für sie eine große Enttäuschung wäre, also legte ich mich wieder ins Bett und habe mich übergeben ... Ich bin wirklich sehr unglücklich, weil niemand da ist, dem man die komischen Dinge erzählen kann, die einem zustoßen, und darin besteht doch der halbe Spaß des Lebens, nicht wahr? (5)
Nicht nur im wehrhaften, verwundenden Witz, auch im Witz der Verzweifelung, im Witz, der die eigenen Wunden zudeckt, hat es Nancy Mitford im Laufe ihres Lebens weit gebracht. Dieses Leben war keineswegs so munter und sorgenarm, wie man nach einem flüchtigen Blick auf ihre "leichten" Romane vermuten könnte. Es war über größere Strecken, namentlich, was das Verhältnis zu den Männern anging, sogar ziemlich traurig. Auf die katastrophale Beziehung zu Hamish St. Erskine folgte die unglückliche Ehe mit Peter Rodd. Und die große Liebe ihres Lebens, die sich schließlich doch noch einstellte, galt einem Mann, der diese Liebe zwar so erwiderte, wie Nancy Mitford es sich wünschte, für den sie aber trotzdem immer nur eine Geliebte blieb, eine unter mehreren.
Als sie ihn kennenlernte, während des Zweiten
Weltkriegs in London,
hatte es die Familie Mitford längst zu einer ominösen
Bekanntheit
in der englischen Öffentlichkeit gebracht. Nancy selbst hat an der
Kette der Skandale, die sich im Laufe der dreißiger Jahre mit dem
Namen Mitford verbanden, nur geringen Anteil gehabt. Sie machte sich
vor
allem lustig über das Treiben einiger ihrer Schwestern und
bemerkte
erst spät, daß dort wo politische Exzentrik in Wahn
umschlug,
auch ihr eigener Witz an eine Grenze stieß.
Ihre Schwester Diana - dies war der erste Skandal -
trennte
sich 1932 von dem Mann, den sie 1929 geheiratet hatte, von Brian
Guiness,
dem Erben des Brauerei-Imperiums, dem Vater ihrer Kinder, weil sie in
Liebe
zu Oswald Mosley entbrannt war, dem Gründer der "British Union of
Fascists", der sich von seinen Getreuen in getreuer Übersetzung
aus
dem Deutschen als "Leader" bezeichnen ließ. Auch die noch
jüngere
Schwester Unity wurde vom Eifer für den Faschismus ergriffen und
machte
Ernst mit einem Vorsatz, den sie schon im Kinderzimmer in Swinbrook
gefaßt
hatte: nach Deutschland gehen und den Führer kennenlernen. Die
Geschichte,
wie sie diesen Plan in die Tat umsetzte, ist lang und grotesk. Sie
ließ
sich von ihren Eltern einen Sprachkurs in München bezahlen,
besuchte
dort regelmäßig die Osteria Bavaria, wo Hitler mit anderen
Nazi-Größen
verkehrte, und starrte den Führer so lange an, bis er sie eines
Abends
an seinen Tisch bitten ließ.
Hitler war entzückt. Unity sah nicht nur gut aus,
sie stammte auch aus dem englischen Hochadel und gab sich überdies
sogleich als glühende Faschistin zu erkennen. Hitler erkannte
ihren
propagandistischen Wert und hatte nichts dagegen, daß sie sich
von
diesem Tag an so oft als möglich und für die
Öffentlichkeit
diesseits und jenseits des Ärmelkanals gut sichtbar, in der
Nähe
Hitlers zeigte, bei den Nürnberger Parteitagen, bei den
Olympischen
Spielen und anderswo. Es kam so weit, daß Lord Rededale sich
genötigt
sah, gegenüber der Presse seines Landes eine bevorstehende
Verlobung
seiner Tochter mit Herrn Hitler zu dementieren.
Jessica Mitford, die im Gegensatz zu ihren übrigen
Schwestern damals mit dem Kommunismus sympathisierte und ihrerseits
für
Schlagzeilen sorgte, als sie Anfang 1937, noch minderjährig, von
daheim
ausriß, um mit einem Neffen von Winston Churchill auf der Seite
der
Republikaner am Spanischen Bürgerkrieg teilzunehmen, hat in ihren
Memoiren beschrieben, wie Nancy auf die faschistischen und
antisemitischen
Neigungen ihrer Schwestern Unity und Diana reagierte:
Nancy machte wie üblich einen Witz aus der ganzen Sache; sie behauptete, sie habe im Stammbaum unserer Familie eine jüdische Urgroßmutter mit Namen Fish entdeckt, und drohte Unity und Diana, die darüber furchtbar wütend wurden, sie werde das Gerücht ausstreuen, wir alle seien zu einem Sechzehntel Juden. (6)
Nach dem Krieg, als das ganze Ausmaß der
faschistischen Barbarei
sichtbar wurde, fand auch Nancy Mitford solche Witze nicht mehr
komisch.
Den 1935 erschienenen Roman Wigs on the Green, in dem sie die
"British
Union of Fascists" und einige ihrer eifrigsten Mitglieder auf den Arm
genommen
hatte, wollte sie um keinen Preis noch einmal gedruckt sehen, als ihr
Verleger
Hamish Hamilton seiner inzwischen zum literarischen Star aufgestiegenen
Autorin die Zustimmung zu einer Neuauflage ihrer verschollenen Romane
aus
der Vorkriegszeit abzugewinnen versuchte. An Evelyn Waugh, ihren Freund
und Ratgeber in literarischen Dingen, schrieb sie 1951: "Wigs on the
Green ist absolut unmöglich. Es ist seither soviel geschehen,
daß Witze über die Nazis nicht mehr komisch, sondern nur
noch
geschmacklos wirken. Immerhin ist das Buch 1934 geschrieben, ich konnte
wirklich nicht voraussehen, was danach noch alles passieren
würde."
(7)
Nancy Mitford besaß ein scharfes Auge für das
Charakteristische und das Absonderliche ihrer Zeit, ihrer Klasse und
ihrer
Gesellschaft, aber in politischen Dingen war sie naiv, und in dem, was
sie hier an Evelyn Waugh schreibt, könnte man eine Art
Eingeständnis
ihrer Naivität sehen. Man hat an ihren Romanen, auch in neuerer
Zeit
und nicht nur in Amerika, zuweilen das Fehlen einer Botschaft
bemängelt
- in Deutschland vor allem auch das Fehlen einer Auseinandersetzung mit
der politischen Wirklichkeit ihrer Zeit. Man hat ihr vorgeworfen, sie
habe
in ihren Romanen ein verklärtes Bild ihrer Familie geliefert. Sie
habe den düsteren Hintergrund, vor dem sich das Treiben der Lords
und Ladies und ihrer Nachkommen in der Realität abspielte, den
politischen
Wahnwitz und die politische Schuld in ihrer Familie verschwiegen.
Geschwiegen
hat sie tatsächlich. Aber wohl nicht, um zu vertuschen (nach
soviel
Publicity gab es nichts mehr zu vertuschen), sondern vielleicht aus
einer
Art intuitiver Weisheit - weil sie nach ihrer politischen Groteske Wigs
on the Green erkannte oder spürte, daß gerade jenes
literarische
Instrument, das sie mit der größten Meisterschaft zu
handhaben
wußte, der Witz in seinen vielfältigen Spielarten, für
die Auseinandersetzung mit dem Faschismus nicht taugte. Jedenfalls
nicht
in ihren Händen.
Während des Zweiten Weltkriegs lernte Nancy Mitford in
London einen
gebildeten, charmanten und auf charmante Weise von sich selbst
eingenommenen
Franzosen kennen und verliebte sich in ihn. Gaston Palewski war ein
enger
Mitarbeiter von Charles de Gaulle, der damals, nach der Kapitulation
Frankreichs,
aus dem Londoner Exil den Widerstand der "Freien Franzosen" gegen die
deutsche
Besetzung zu organisieren versuchte. Die politische Lage schien
hoffnungslos.
Die Aussicht auf eine Befreiung Frankreichs war in weite Ferne
gerückt.
Aber es gab viel zu tun, und Palewski war von früh morgens bis in
den späten Abend in Carlton Gardens, dem Londoner Hauptquartier de
Gaulles, beschäftigt. Schon in der ersten Zeit ihrer Liebe zu
Gaston
Palewski verbrachte Nancy mehr Zeit mit Warten auf ihren "Colonel" als
mit ihm selbst. Daran änderte sich auch später, nach dem Ende
des Krieges nichts, obwohl sie, sobald die Umstände es erlaubten,
nach Paris übersiedelte, um in seiner Nähe zu sein. Sie hat
mit
ihm nie unter einem Dach gelebt, und sie akzeptierte die
Begründung,
mit der er dem Gedanken an eine Heirat auswich. Eine geschiedene Frau,
eine Engländerin zudem, könne er mit Rücksicht auf seine
politische Karriere einfach nicht heiraten. So bedrückend und
demütigend
der Status der heimlichen, gleichsam auf Abruf bereitstehenden
Geliebten
eines vielbeschäftigen Politikers, der obendrein noch ein
notorischer
Frauenverehrer war, in vieler Hinsicht sein mußte - Nancy Mitford
hat die durch keinerlei gemeinsame Alltäglichkeit verringerte
Distanz,
die zwischen ihr und Gaston Palewski bestehen blieb, wie es scheint,
nicht
nur erlitten, sondern auch genossen. Diese Distanz mußte immer
wieder
aufs neue überbrückt werden - durch Unterhaltsamkeit, durch
Witz.
Daß Palewski von Nancys Kümmernissen nichts wissen wollte,
entsprach
in gewisser Weise ihrer eigenen Neigung, Wunden durch Witze zu
überdecken.
Ihre Kümmernisse langweilten den "Colonel". "Des histoires!"
forderte er. Geschichten! Er war ein anspruchsvoller Mann, wenn es um
Geschichten
ging, und an Selbstbewußtsein fehlte es ihm nicht. "Sie werden
nie
einen guten Roman schreiben, in dem ich nicht vorkomme", sagte er
einmal
zu Nancy - und hat Recht behalten, oder vielmehr: sie hat ihn Recht
behalten
lassen, indem sie ihm tatsächlich in jedem der vier
äußerst
erfolgreichen Romane, die sie nach dem Zweiten Weltkrieg
veröffentlichte,
einen Auftritt verschaffte, zweimal in einer zentralen, zweimal in
einer
Nebenrolle - zunächst unter dem Namen Fabrice, Duc de Sauveterre,
später als Charles-Edouard de Valhubert. Den ersten dieser Romane,
der ihren literarischen Ruhm begründete, Englische Liebschaften
oder In Pursuit of Love, Ende 1945 erschienen, hat sie Gaston
Palewski
auch gewidmet.
Harold Acton, Nancy Mitfords erster Biograph, hat
über
Englische Liebschaften geschrieben:
Dieses Buch, obgleich ohne intellektuellen Anspruch geschrieben, werden die Historiker als ein authentisches Zeugnis einer bestimmten Ära der englischen Zivilisation und des gesellschaftlichen Lebens auf den Landsitzen des Adels noch zu Rate ziehen, wenn ambitioniertere soziologische Romane längst in staubigen Regalen vermodern. (8)
Tatsächlich ist das, was wir in diesem und den anderen "unpolitischen" Gesellschaftsromanen von Nancy Mitford über die Gesellschaft, in der sie sich auskannte und in der sie sich bewegte, und über die nicht immer bloß feine englische Art erfahren, in hohem Maße aufschlußreich. Aufschlußreich ist auch, was sie, vor allem in ihren beiden letzten Romanen, mit feinem Gespür für die feinen Unterschiede, die die Eigenart und den Charakter benachbarter und doch verschiedener Zivilisationen ausmachen, über die Nähe und die Ferne zwischen England und Frankreich zu sagen hat. Aber nicht allein und nicht in erster Linie die Aufschlüsse, die sie dem Leser bieten, sondern (wie es sich für die Kunst gehört) vor allem die Art, in der sie dies tun, machen die Romane von Nancy Mitford - außer Englische Liebschaften auch Liebe unter kaltem Himmel aus dem Jahre 1949, Ein Segen für die Liebe von 1951 und Die Frau des Botschafters aus dem Jahre 1960 - zu einer Lektüre, die bis heute nichts von ihrer Ergötzlichkeit verloren hat.
Nancy Mitford starb vor zwanzig Jahren, am 30. Juni 1973, in Versailles bei Paris. Sechs Jahre vor ihrem Tod, an Allerseelen 1966, zählte sie in einem bekümmerten Brief an einen Bekannten, Christopher Sykes, die Namen einiger verstorbener Freunde auf, die ihr besonders nahe gewesen waren und ihr nun besonders fehlten:
Ich denke heute an Robert Byron - an meinen Bruder Tom, an Victor Cunard, Mrs. Hammersley, Evelyn Waugh und Roger Hinks. Es sind die Menschen, mit denen man durch Witze verbunden ist, die man nachher am meisten vermißt - die Liebenswürdigen, die Guten und Aufrechten viel weniger. (9)
Ergeht es uns Lesern mit den Büchern nicht oft ganz
ähnlich?
Die guten und aufrechten, die wohlmeinenden, rechthabenden und tiefen
unter
ihnen, die halten wir in Ehren. Die sind uns wertvoll und teuer. Aber
jene,
die sich durch ihren Witz mit uns verbinden, die lieben wir - zumindest
vermissen wir sie, wenn sie uns abhanden kommen, mehr als jene anderen.
Einer altehrwürdigen Theorie zufolge bringt der Witz
das weit Auseinanderliegende auf überraschend kurzem Weg zusammen.
Er schlägt Verbindungen, wo die meisten lange Gedankenstrecken vor
sich sehen, die abzuwandern mit Mühe verbunden ist. Der Witz
findet
- uns zum Vergnügen und zur Lust - Abkürzungen, ist schneller
am Ziel einer Einsicht, einer Behauptung, eines Urteils, als es auf den
geregelten Bahnen der Sammlung und Verknüpfung von Gründen,
Indizien,
Beweisen, Gesichtspunkten oder Geschichten je möglich wäre.
Der
Preis der Kürze des Witzes besteht darin, daß seine
Einsicht,
seine Behauptung, sein Urteil am Ende punktförmig dastehen, als
Pointe
- ohne Stütze, Netz und Sicherheit. Ein ausgemachter Leicht-Sinn!
Leute, die sich auf ihren Fleiß und ihre Gründlichkeit etwas
zugute halten, werden da leicht mißtrauisch. Sie machen dem Witz
diesen Leichtsinn und seine Mühelosigkeit, seine
Leicht-Fertigkeit,
zum Vorwurf. Er sei nicht mit Arbeit verbunden, wenden sie ein. Aber
das
ist nur allzu oft ein Mißverständnis. "Wenn die Leute
wüßten",
schrieb Nancy Mitford einmal, "wie mühselig und was für eine
Plackerei das Bücherschreiben ist, würden sie nicht immer in
dieser albernen Weise so tun, als beneideten sie einen!" (10) Denn Witz
ist durchaus mit Arbeit verbunden. Leicht und leichtfertig wirkt er
erst,
wenn diese Arbeit getan ist, wenn sie, unsichtbar gemacht, hinter ihm
liegt.
Es ist die Arbeit, die Nancy Mitford in ihren "leichten" Romanen auf
sich
genommen hat, die Arbeit, aus gewöhnlicher Weitschweifigkeit
Kürze,
aus alltäglicher Schwere Leichtigkeit zu gewinnen und obendrein
die
eigenen Wunden und Kümmernisse so zu verpflegen und zu verbinden,
daß dem Selbstmitleid keine Chance bleibt, das Werk des Witzes
und
der Kunst in Weinerlichkeit und Larmoyanz zu ertränken.
Fußnoten
1) Twentieth Century Authors. 1st
Supplement,
hrsg. v. S. J. Kunitz, New York: Wilson 1955, S. 677f. 2)
Jessica Mitford, Hons and Rebels, London: Victor
Gollancz 1960,
S. 36 3) Selina Hastings, Nancy Mitford. Eine
Biographie,
Frankfurt: Frankfurter Verlagsanstalt 1992, S.52 4)
Jessica Mitford, Hons and Rebels, S. 30f. 5)
Zit. n. Hastings, S. 97 6) Jessica Mitford, Hons
and Rebels, S. 80 7) Zit. n. Hastings, S. 129,
Fn.
6 8) Harold Acton, Nancy Mitford. A Memoir,
S.
59 9) Zit. n. Acton, S. 175 10) Zit.
n. Hastings, S. 282.
Zurück zu Verstreute
Werke
Leicht gekürzte Fassung eines Radio-Essays für den Süddeutschen Rundfunk, S2 Kultur, Erstsendung 8. Juni 1993, abgedruckt in der Frankfurter Rundschau, 3. Juli 1993.